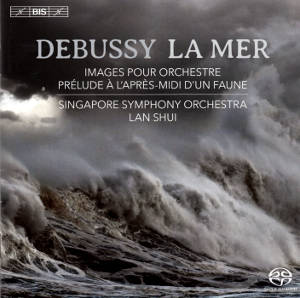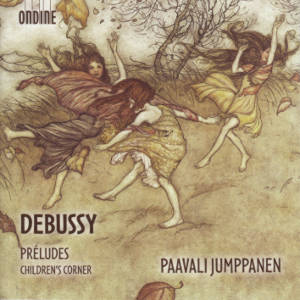Claude Debussy
Hör-Tipps anhand von ausgewählten Werken
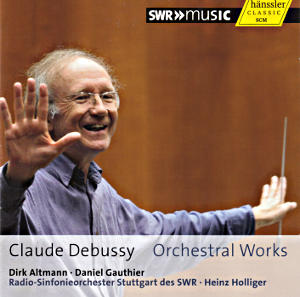
Douce et expressive (süß und ausdrucksvoll) setzt eine Soloflöte in die Stille ein; das Orchester „erwacht“ staunend, schlaftrunken, mit magischen Harfenglissandi und sich gleichsam räkelnden Horn-Gesten. Die Uraufführung von Debussys Orchesterstück Prélude à l’après-midi d’un faune (Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns) 1894 war, wie Pierre Boulez feststellte, auch ein „Erwachen der modernen Musik“. Damit gemeint ist die Eigenberechtigung der Klangfarben, wie es sie vorher wahrscheinlich nur in Wagners Parsifal gegeben hatte. Schnell war bereits die zeitgenössische Kritik für dieses Vorherrschen des Klanges mit dem Etikett „Impressionismus“ zur Hand, das Debussy jedoch als mißverständlich ablehnte: Der Vorwurf des Vagen, Nebulösen, Verschwommenen, der in diesem Schlagwort mitschwingt, verträgt sich tatsächlich nicht mit der präzisen, oft gar als „berechnet“ empfundenen Kompositionsweise Debussys.
Werk-Auswahl
- Orchesterwerke: Prélude à l’aprés-midi d’un faune
- Kammermusik: Streichquartett g-Moll op. 10
- Orchesterwerk: La mer, dritter Satz, Dialogues du vent et de la mer
- Klaviermusik: Prélude I/10 La Cathédrale Engloutie
- Oper: Pelléas et Mélisande: zweiter Akt, erste Szene: „Vous ne savez pas où je vous ai émenée?“
Nicht nur die Magie des Klanges, die flüssige, mehrdeutige Formgebung des Vorspiels zum Nachmittag eines Fauns waren unerhört, sondern auch das Verhältnis von Textvorlage und Musik, welches der 32jährige Debussy in eine eigentümlich schwebende Balance brachte. Einerseits bezieht sich Debussy sowohl im Titel auf das Gedicht Der Nachmittag eines Fauns von Stéphane Mallarmé, als auch in der Gesamtstruktur: 110 Verse des Gedichtes entsprechen 110 Takten des Orchesterstückes. Auch die solistische Verwendung der Flöte, bei Mallarmé das Instrument des Fauns, und die Cymbales antiques (die Glockenklänge) – Mallarmé selbst hatte sein Gedicht als „antique“ charakterisiert – wirken als Indizien für die Nähe von Text und Musik. Andererseits will das Stück kein musikalisches Abmalen sein, sondern ein Vorspiel, welches das Lesen des Gedichtes keineswegs überflüssig machen soll.
Man könnte das Werk als Widerhall einer Lektüre, als musikalisch gespiegeltes Abbild eines Leseaktes deuten: Die Melodielinie der Soloflöte, aus der alles erwächst, wäre so etwas wie die erste Verszeile, auf die sich alles spätere stützt. Folgerichtig kommt eine solche von Stille eingehüllte erste Zeile nicht mehr vor: Wenn die Melodie wiederholt wird, ist sie bereits von weichen, sinnlichen Streicherakkorden umgeben. Entscheidend bei diesem Nachmittag ist wohl das Begreifen des Wechselspiels aus Spannung und Beruhigung, Einatmen und Ausatmen. So führt bereits die Oboe, die nach einem unmerklichen Klangfarbenwechsel die Flöte weiterführt, zu schaudernder Erregung: Man höre etwa die lockenden Violinen. Jede Wiederkehr des Flötenthemas wird, variiert, in eine neue Orchesterumgebung getaucht und treibt die Spannungskurve weiter. Eine insistierend repetierte Bewegung der Celli bringt in immer neuen Anläufen eine Art diskreten Höhepunkt hervor: eine sehnsüchtige, weitgespannte, an Wagner erinnernde Melodie, deren Liebesseufzer (Holzbläser) deutlich sind. Bei allem instrumentalen Singen ist durch rezitativartige Passagen (Sextakkorde) die Nähe zum lyrischen Sprechen immer wieder hergestellt. Das Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns verhält sich respektvoll gegenüber dem Gedicht – und ist doch mehr, indem es Unsagbares spürbar macht.
Um die Neuartigkeit dieser Klangfelder, die Debussy hier erschlossen hatte, in ihrer Einzigartigkeit zu erfahren, ist ein Vergleich mit Kammermusik aus der Zeit unmittelbar davor nützlich. Auch das Streichquartett op. 10 trägt Züge einer Variationsfolge in sich – allerdings im Gewand der traditionellen Viersätzigkeit. Das kräftige, sehr entschiedene unisono-Motiv des ersten Satzes findet sich als thematischer Kern im ganzen Quartett wieder: als Maßnahme zur Vereinheitlichung. Dieses Motiv in der Bratsche irritiert die G-Dur-Pizzicato-Akkorde des zweiten Satzes, taucht im selben Satz in der Melodie der ersten Violine wieder auf, wird versteckt in den dritten Satz eingearbeitet und liegt auch dem letzten Satz zugrunde. Dieses so beharrlich festgehaltene Thema gewinnt seine Kraft nicht nur durch seine rhythmische Fassung, sondern auch durch seine nur fünf verwendeten Töne, die einen naturhaften Eindruck bewirken; verstärkt wird dieser Eindruck der Entschiedenheit vor allem im ersten Satz noch durch die häufigen Wiederholungen von Takteinheiten, die den Bau dieses Satzes überaus tragfähig machen. Alles bekommt eine Entschiedenheit, die mit den sensiblen Klangschwebungen des Fauns nicht zusammenzubringen ist.
Nicht Sinfonie, nicht Dichtung
Wer erwartet hatte, dass Debussy nun das magische Schweben des Fauns als „Impressionismus“ weiterverfolgen und ausbauen würde, sah sich durch die nachfolgenden Kompositionen getäuscht. La mer, geschrieben 1903–1905, hält sich durch seinen Untertitel „Sinfonische Skizzen“ von zwei Gattungen, der Sinfonie und der programmatischen Tondichtung, fern: Trotz der drei Teile handelt es sich um keine regelgerechte Sinfonie, trotz des Titels ist Das Meer keine abbildende Ozeanmusik. Und doch fließen Elemente aus beidem zusammen. Im letzten Satz Dialogue du vent et de la mer (Dialog zwischen Wind und Meer) stehen sich zwei Themenprinzipien gegenüber: ein aufsteigendes, das gewaltigen Tumult bewirkt (in der leise-untergründigen, doch ruppigen Phrase der Bässe), und ein chromatisch absteigendes (vorgebildet in den Oboen) – welches für Wind und welches für Meer steht, sei der Imagination des Hörers überlassen. Diese beiden Motive werden nun schrittweise ausgeweitet und miteinander kombiniert. Eine erste Fassung des aufsteigenden Themas, das aus Ganztönen besteht, wird exponiert; ein sanfteres, sich wiegendes Thema der Holzbläser wird dem fordernden ersten Thema bei übergelegt. Aus dieser fast dramenartigen Konfrontation und ihren verschiedenen Variationen erwächst dieser Satz, nicht aus einer vorgegebenen Form. Dabei scheint dem aufsteigenden Thema vor allem spritzige, gischtartige Bewegung zuzugehören, dem absteigenden dagegen die Beruhigung: etwa bei der farbig illustrierten Idylle oder der schwelgerischen Hymne! Zusammengebunden wird das Widerstrebende durch einen Choral der Blechbläser. Wind und Meer vereinen sich zu einem musikalischen Naturschauspiel.
In den Préludes für Klavier stößt man auf eine ähnliche Scheu, ein Programm zu verwirklichen, wie in L’après-midi d’un faune und La mer. In der handschriftlichen Fassung finden sich die Titel der Préludes erst am Ende der Stücke und noch in Klammern gesetzt – als ob erst nach Beendigung der Komposition der Inhalt klar geworden wäre. Bei La Cathédrale Engloutie wird die musikalische Situation durch den Titel noch mit einer zusätzlichen Bedeutung aufgeladen. Aus einem fremden, seltsamen Klang, der einen riesigen leeren Raum aufzumachen scheint, steigt ein Gesang in Quintparallelen empor wie ein lang vergessener Mönchschoral. Ein lange gehaltenes hohes „e“ und weitere Töne schweben hallend durch diesen Raum. Bleibt man in diesem Bild, beginnt das Dunkel sich mehr und mehr zu lichten, bis ein atemberaubender, vielstimmiger, wie von Glocken begleiteter Gesang durch einen leuchtenden Raum ertönt: eine Erinnerung an großartige Zeiten. Der Gesang verliert sich wieder in dem Raum, löst sich auf. Erst der Titel am Schluß bestärkt den Eindruck: Wir sind Zeugen des phantomhaften Auftauchens einer versunkenen Kathedrale geworden.
Während der Entstehung seiner einzigen vollendeten Oper Pelléas et Mélisande (UA 1902 an der Pariser Oper) sprach Debussy häufig von der zu starken Vorherrschaft der Musik in den meisten Opern; zur selben Zeit lernte er Mussorgskys Boris Godunow kennen. Daraus kann man Rückschlüsse auf seine Konzeption von Oper ziehen. Wie im Boris findet sich in Pelléas et Mélisande häufig der deklamative Sprechgesang, der in einer fein gezeichneten orchestralen Umgebung angesiedelt ist. Leise Töne dienen zur Schilderung der Atmosphäre. So entsteht mit stellenweise extrem sparsamen Mitteln eine traumhafte Stimmung. In der Einleitung zu einer der Schlüsselszenen, der ersten Szene des zweiten Aktes, findet sich in den Flöten das „Doux et expressif“ des Fauns wieder. Pelléas, der die mit Golaud verheiratete Mélisande liebt, tritt mit dieser zu einem Brunnen im Park. Ein winziger Flötentupfer skizziert das klare Wasser, das Mélisande bemerkt: Das hat natürlich symbolische Bedeutung, da es den „Blinden die Augen öffnet“. Auch Liebesblinden: Zuerst tauchen die langen Haare Mélisandes in das Wasser, dann fällt ihr Ehering hinein. Im Spiel mit Pelléas, den sie unbewußt liebt, entledigt sie sich ihrer Ehe. Golaud, ihr Mann, ist zur selben Zeit bei der Jagd vom Pferd gefallen und hat sich leicht verletzt. Zur Symbolik dieser Szenen ist wohl nichts weiter zu sagen; wichtiger ist, dass Debussy durch seine reduzierte und sensible Musik den Symbolen Raum läßt, sich in all ihren Andeutungen zu entfalten.
Prof. Dr. Michael B. Weiß