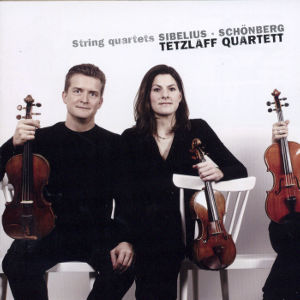Tetzlaff Quartett
Schubert • Haydn

Ondine ODE 1293-2
1 CD • 76min • 2015
29.03.2017
Künstlerische Qualität:![]()
Klangqualität:![]()
Gesamteindruck:![]()
Wäre mir diese Interpretation der beiden hier versammelten Meister in früheren Jahren begegnet, ich hätte wohl mit allen mir zu gebotene stehenden Mitteln über die geradezu haarsträubend provokante Betrachtung geschimpft, die so gar nichts mit „meinem“ Haydn, „meinem“ Schubert gemein hat. Doch im Laufe der Zeit sollte man gelernt haben, sich auch auf andere Standpunkte zu stellen und deren Blickwinkel zumindest als Möglichkeit in Erwägung zu ziehen. Was im konkreten Falle heißt: Die musikalische Nahtod-Erfahrung des rabiaten Schubert-Quartetts und das zerklüftete, erschreckend wilde, völlig aus dem klassischen Lot geratene Opus 20 Nr. 3 des Eszterházyschen Hofkapellmeisters so über sich ergehen zu lassen, wie sie uns hier hypothetisch entgegenklingen – bis zum röchelnden Verstummen mitunter, wie über fernen Nebellandschaften zuckende Blitze oder Seismogramme nicht mal mehr erschütterter, sondern am Boden liegender Seelen, die kaum noch in der Lage sind, ihre letzten Visionen von Gesang und Schönheit zu lispeln ...
Ich lasse mich also darauf ein. Finde auch mancherlei klanglich raffinierte Momente, beeindruckende Tremolandi-Strecken (bei Schubert), die weniger grollen als fauchen wie die schwefelhaltige Zugluft am nicht ganz geschlossenen Tor zur Hölle. Ja, das kann man so machen. Doch wenn, dann muß es fesselnd bleiben und nicht zu Stereotypen herabsinken wie im Andante con moto etwa, wo die Sechzehntel-Achtel-Aufschreie (fz) zwischen den brodelnden p-ff-p-Wölbungen so regelmäßig-gleichbleibend abgespielt werden, daß sich ein (vermutlich unbeabsichtiger) Automatismus eingestellt: Beim nächsten Mal weiß ich, was kommt, und der dezent emporgehaltene Handrücken verbirgt nur mühsam mein Gähnen.
Bei Haydn ist’s prinzipiell nicht anders. Ganz äußerlich: Die erste Phrase des Kopfsatzes ist nicht, wie TQ im beigefügten Gesprächstext behauptet, fünf Takte lang, sondern sieben. Weit weniger äußerlich: Die extrem fragmentierte, gewiß aufsehenerregende Ruinenlandschaft des g-moll-Quartetts stammt nicht aus der Feder eines resigniert habenden Junkers von Bleichenwang, sie ist der Sturm-und-Drang dessen, der gerade in damaligen Jahren nicht nur ein-, sondern „vielmoll” die Perücke in die Ecke geschmissen hat. Davon müßte vielleicht doch etwas erhalten bleiben, und sei’s auch nur in der unschematischen Nuancierung der Valeurs, die diese grandiose Partitur enthält. Dass ausgerechnet im allerletzten Takt des Finalsatzes dem Cello ein winziges Ritardando entfährt, ist ein abschließendes Indiz für den Riß zwischen Anspruch und Einlösung: Hier handelt es sich durchaus, wie TQ im beigefülgten Gesprächstext sagt, um das „Bild von einem Choleriker, der vom Hundersten ins Tausendste springt, auch mit einem ständigen wilden Wut-Gestus” umherfährt. Einem solchen „Wütherich” müßte dann freilich die Zornesröte ins Gesicht schießen – und wenn er endlich durch ist mit seinem Rasen, dann ließe er sich nicht erschöpft ins Fauteuil fallen, sondern löste sich vor den Augen des Betrachters unvermittelt in Nichts auf. Eine tobende Sprechblase, die leise zerplatzt. Dazu hätte er aber vorher – toben müssen.
Rasmus van Rijn [29.03.2017]
Anzeige
Komponisten und Werke der Einspielung
| Tr. | Komponist/Werk | hh:mm:ss |
|---|---|---|
| CD/SACD 1 | ||
| Franz Schubert | ||
| 1 | Streichquartett Nr. 15 G-Dur op. 161 D 887 | 00:50:17 |
| Joseph Haydn | ||
| 5 | Streichquartett g-Moll op. 20 Nr. 3 Hob. III:33 | 00:24:59 |
Interpreten der Einspielung
- Tetzlaff Quartett (Streichquartett)