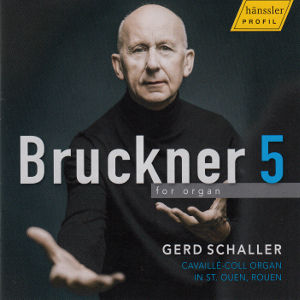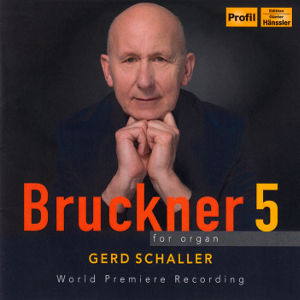DG 002894775377
1 CD • 83min • 2004
22.03.2005
Künstlerische Qualität:![]()
Klangqualität:![]()
Gesamteindruck:![]()
Das offizielle Antritts-Konzert von Christian Thielemann bei den Münchner Philharmonikern Ende Oktober 2004 erregte große Aufmerksamkeit. Auf dem Programm stand Bruckners fünfte Sinfonie, mit der auch Sergiu Celibidache 1985 den Gasteig eröffnet hatte – damals durchaus nicht ohne Hintergedanken: Immerhin zitierte Bruckner ausgiebig Mozarts Requiem; zu allem Überfluß bot Sergiu Celibidache vor der Pause die Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz und meinte dazu lakonisch: „Gasteig ist so ein toter Raum – braucht Requiem zur Eröffnung...“
Christian Thielemanns Konzert nun wurde nicht weniger kontrovers diskutiert als seinerzeit das von Sergiu Celibidache, sogar in musikwissenschaftlichen Kreisen. Selbst die Mitteilungsblätter der Internationalen Bruckner Gesellschaft (Nr. 63, S. 25f) brachten ausnahmsweise eine zweiseitige Rezension der drei Konzerte. Bertram Müller, der immerhin über Bruckners fünfte Sinfonie promoviert, ein bemerkenswertes Buch darüber geschrieben hat und einer ihrer besten Kenner ist, kam darin zu einer vernichtenden Kritik. Von Christian Thielemanns Konzert kann man sich nun anhand des bei der Deutschen Grammophon erschienenen, nachbearbeiteten Mitschnitts selbst ein Bild machen, auch wenn man nicht in München live dabei war. Dabei liegt es nahe, die CD insbesondere mit den Mitschnitten unter Celibidache vom Februar 1993 (EMI 5 56691 2) und den Wiener Philharmoniker nunter Nikolaus Harnoncourt vom Juni 2004 zu vergleichen (RCA/BMG 82876 60749 2) – Konzerte, die vom Publikum mit ebenso nicht enden wollendem Jubel bedacht worden waren wie das von Thielemann.
Mein spontaner erster Höreindruck von Thielemanns Interpretation: Das Imperium schlägt zurück – und zwar gegen jeden Ansatz zu historischer Informiertheit. Als peinlich mag mancher bereits das Beiheft empfinden, in dem Christian Thielemann unter dem trotzigen Titel „Stellt euch dabei vor, was ihr wollt!“ drei Seiten lang über seine Sicht des Werkes spricht – einschließlich einiger Deutschtümeleien: Wenn er mit Bruckner „eben nicht St. Florian, sondern eher die Marienkirche in Danzig“ assoziiert, an „Ostpreußen, an die deutsche Backsteinarchitektur, die Architektur der Hansestädte“ oder sogar „die großen Wälder und Bäume in Ostpreußen“ denkt, dann fühlt man sich unwillkürlich an manche der sich an die Nationalsozialisten anbiedernden Vorworte der Ausgaben von Robert Haas erinnert – beispielsweise an das zur Achten Sinfonie, in dem Haas im April 1939 schrieb, er empfände es „als ein Zeichen der Vorsehung, daß die wiederhergestellte Partitur gerade in diesem Jahr als Gruß der Ostmark erklingen kann.“ Und so wundert es auch nicht, daß Thielemann für sein Antrittskonzert zwischen der fünften und achten Sinfonie schwankte, jenem vom Komponisten selbst ausdrücklich nationalistisch intendierten Monumentalwerk über den Mythos vom „Deutschen Michel“, den Haas erschreckend treffend „in der großdeutschen Idee als geschichtlicher Geisteshaltung“ betrachtete.
Das von Thielemann Geschriebene ist auch noch in anderer Hinsicht entlarvend: Nur jemand, der großen Wert auf sein eigenes Interpretentum legt, kann zu schreiben wagen: „Ich habe keine Botschaft, die ich meinem Publikum mit dieser fünften Symphonie von Anton Bruckner aufdrängen will.“ Wer ausschließlich musiziert, damit „dem Hörer eine Gänsehaut über den Rücken läuft,“ bei dem bleibt das Anliegen des Komponisten zwangsläufig auf der Strecke. Wer ausschließlich die „Wiederentdeckung der Langsamkeit“ heraufbeschwört, der macht das Tempo zum Mittel, das vom Zweck geheiligt wird und keine Rücksicht auf Wiener Spieltraditionen des 19. Jahrhunderts nimmt, geschweige denn auf die Vorschriften und Absichten des Komponisten. Und wer das Klischee von der „Übertragung des Orgelklangs auf das Orchester“ bedient, stellt den Klang in den Mittelpunkt und vernachlässigt die Struktur in sträflicher Weise – und macht deutlich, daß er zwar diesbezüglich Eugen Jochum und Karl Böhm nachplappern kann, aber von Bruckners eigentlichen klanglichen Absichten wohl nur wenig versteht, denn Bruckner schrieb seine großen Sonaten-Fantasien ja mit gutem Grund für Orchester und nicht für Orgel. Dies zeigt sich übrigens nicht zuletzt daran, daß die Versuche, Bruckner-Sinfonien in Gänze auf die Orgel zu übertragen (beispielsweise durch Ernst-Erich Stender, Thomas Schmögner oder Lionel Rogg), in vieler Hinsicht unbefriedigend bleiben und eine entscheidende klangliche Dimension vermissen lassen. Das typische Wiener Orchester zu Bruckners Zeit – Streichinstrumente mit Darmseiten, ohne Vibrato; eng gebohrte Blechbläser; Holzflöten; Wiener Oboen; Deutsche Klarinetten und Fagotte – war überdies noch auf Eigenfarbigkeit der Instrumente ausgelegt, während die von Bruckner bespielten großen Orgeln in den halligen Kirchenräumen einen typischen Verschmelzungsklang erzeugten, wie er – leider – heute auch den meisten Orchestern als Klangideal vorschwebt, aber im 19. Jahrhundert keineswegs selbstverständlich war. Die Eigenfarbigkeit der Instrumente hat jedoch einen hohen Anteil an der Hörbarmachung der kontrapunktischen Faktur und der Strukturen, was Bruckner selbst sehr am Herzen lag, doch bei den meisten modernen Orchestern auf der Strecke bleibt, wenn man nicht– wie Harnoncourt in seinem Probenmitschnitt unter Beweis stellt – eine akribische Detailarbeit vornimmt. Nicht zuletzt deshalb wirken jüngere Bruckner-Interpretationen von Musikern wie Harnoncourt, Norrington oder Herreweghe so bestürzend klar und erhellend, daß sie von Freunden der post-Wagnerschen Klangweihe als Ohrfeige empfunden werden müssen. Doch eben diese Hörer bedient Thielemann. Er vertritt eine Interpretationskunst der schwelgerischen Übertreibungen, ähnlich wie seinerzeit Leonard Bernsteins erste, ausgesprochen „vermahlert“ wirkende Einspielung von Bruckners Neunter mit den New Yorker Philharmonikern von 1965. Steht in der Partitur ein pianissimo? Spielt es leiser! Dreifaches piano? Noch viel leiser! Doch bei solchen Eingriffen geht es meist nicht um die Balance, sondern nur um den Effekt des Moments. Ein Beispiel dafür: Im Finale, ab Takt 163, steht für Pauke dreifaches piano, in Takt 169 bis 172 für Kontrabässe und Celli ebenfalls, und dennoch sind sie kaum zu hören und werden von der Pauke überdeckt (Tr. 4, ab ca 6’58, Bassi 7’10), da Thielemann offensichtlich lediglich auf das vorherige pianissimo/diminuendo der Flöte und Oboe reagierte. Das fortissimo hingegen klingt stets so satt und opulent wie ein Rennwagen mit Turbolader. Zwar ist die dynamische Bandbreite ungeheuer und von den Tontechnikern bestens eingefangen: Man muß ständig nachregulieren, wenn man alles mitbekommen und hören will. Doch der Gesamtklang ist so üppig und kalorienhaltig wie Bruckners Leibgericht: Selch-Fleisch mit Knödeln und Kraut.
Thielemann offenbart schon in seinem Beiheft-Text eine durchaus gespaltene Selbstwahrnehmung. So schreibt er, er neige dazu, „manche Pausen zu verlängern, um die Spannung zu steigern“. Doch oft genug ist das Gegenteil der Fall, beispielsweise in den Generalpausen der Introduktion des ersten Satzes, wo ständiges Vorandrängen und Zurückhalten herrscht und alle Pausen unterschiedlich lang ausgehalten werden, die Generalpause Takt 30 aber wie meist beträchtlich verkürzt wird (Tr. 1, ab 1’07). Oder er beschwört den alten, falsch verstandenen Werktreue-Begriff, wenn er behauptet, Tempo, Dynamik und Klangtransparenz „ohne jegliche Retusche im Orchester“ erzielen zu wollen, aber andererseits durch seine grotesken Verzerrungen von Tempo-Vorschriften, Phrasierungen und Artikulationen Bruckners eigene Angaben geradezu mit neuen Farben übermalt. Bruckner wollte immerhin mit dieser fünften Sinfonie sein wissenschaftlich-kontrapunktisches Meisterstück abliefern; ungeheuer akribisch bezeichnete er in der Partitur zum ersten Mal überhaupt in seinen Werken die Artikulation, mit differenzierten Akzenten ausnahmsweise selbst in den Streichern, und dort tauchen sogar Bogenstrich-Anweisungen auf, die Bruckner vorher nie zu setzen gewagt hatte (entsprechende Angaben in früheren Sinfonien sind sämtlich erst in späteren Umarbeitungen nach Fertigstellung der Fünften entstanden).
Es ist bezeichend für die Interpretation Thielemanns, daß diese wenigen Anweisungen für ihn nicht von Belang sind, insbesondere die Artikulation des Finale-Themas, wo Bruckner die Abschlußnoten mit wiederholten Abstrichen gespielt wissen wollte und ausdrücklich hinschrieb: „Sämtliche Streicher die 3 letzten Noten des Themas immerfort abwärts gestrichen.“ Thielemann hat alles hörbar geändert. Hinzu kommen Bruckners akribische Akzente auf den Anfangsnoten, herausgearbeitet von Harnoncourt mit den Worten: „Hier muß jeder von diesen Einsätzen klingen, als wäre es eine Eins.“ Infolgedessen hört man bei ihm die Faktur des Stimmengeflechts (Harnoncourt, Tr. 4, 1’43) von Anfang an bis zum Ende des Satzes. Auch Celibidache wußte die Münchner Musiker seinerzeit genauso beredt spielen zu lassen (CD II, Tr. 2, 1’57). Thielemann hat nun dem Orchester – das er im Booklet aufschlußreich als „mein Orchester“ bezeichnet – das bei Celibidache Erlernte weitgehend und hörbar ausgetrieben, wenn man die beiden Produktionen miteinander vergleicht, auch wenn Thielemanns Aufführung insgesamt nur wenig kürzer ist (Celi brauchte für das Adagio vier, für das Finale eine Minute mehr; Kopfsatz und Scherzo sind etwa zeitgleich). Wie von Harnoncourt für den Fall der Nicht-Beachtung der Akzente befürchtet, klingt der gesamte Final-Satz bei Thielemann durch die verwaschenen Artikulationen nicht nur „im Ganzen wie ein Zuckerwerk“ (Harnoncourt), sondern regelrecht weichgespült. So setzte Bruckner beispielsweise über jede einzelne Halbe-Note des berühmten Chorals einen sogenannten Keil-Akzent ( ^ ), um ihn Note für Note festzumauern – so auch umgesetzt von Harnoncourt, der dabei noch die besondere harmonische Wendung am Ende herausarbeitete, indem er den Wienern die wunderbar treffende Textierung „Was Gott tut, das ist wohl getan“ vorschlug (Harnoncourt, Tr. 4, 7’00). Thielemann hingegen ließ den ganzen Choral weich, innig-weihevoll und fast legato blasen (auch wenn das – zugegeben – bei Celi nicht viel besser klingt: CD II / Tr.2, 7’42).
Schließlich verraten auch die gewählten Tempi, daß Thielemann die Umsetzung der thematisch-motivischen Struktur des Werkes, an der Bruckner so gelegen war, wohl kaum interessierte. Es gibt erhebliche Schwankungen, zusätzliche Verlangsamungen und Beschleunigungen, und insgesamt folgt die Tempo-Disposition den bekannten, immer noch vorherrschenden Verzerrungen wie im bearbeitenden Erstdruck von Schalk vorgegeben. Wie soll man beispielsweise noch hörend nachvollziehen können, daß das dritte Thema im Finale bereits eine kontrapunktische Zusammenfassung des Oktavsturzes vom Hauptthema und des Mittelsatzes aus dem Gesangsthema in Umkehrung (Streicher unisono) ist, wenn nicht, wie in der Partitur so bezeichnet, alle drei Themen ungefähr das gleiche Tempo haben? (Vergl. Tr. 4, 3’06, bei Thielemann viel langsamer, aber Bruckners leichte Verzögerung bei 3’41 bzw. T. 83 von Thielemann ignoriert, sodann in T. 137, 6’12 ein nicht vorgegebenes Tempo Primo.)
Auch im ersten Satz gibt es die übliche, von Bruckner nicht notierte erhebliche Verlangsamung des zweiten Themas, und Thielemann hat –wie die meisten Dirigenten – das von Bruckner ausdrücklich auf Halbe bezogene Metrum des Adagios (alla breve-Takt!) falsch auf die Triolen-Viertel bezogen, wodurch der Satz unendlich gedehnt wird.
In der Gesamt-Anlage wirkt auch Thielemanns Interpretation der fünften Sinfonie, ähnlich wie die jüngst erschienene Einspielung von Ivor Bolton (Oehms OC 364), wie eine groteske Imitation der legendären Interpretationen Furtwänglers, wobei Thielemann zugegebenermaßen noch einen weit besseren „Wilhelm“ abgibt als Bolton: Es ist nicht zu leugnen, daß Thielemann es oft versteht, sein Publikum zu fesseln –durch eine Hollywood-artige Über-Sentimentalisierung, extrem enges Hypervibrato und beständiges Pathos. Doch dieses gekünstelte Ausdrucksmusizieren als Selbstzweck wirkt nach einiger Zeit ermüdend. Und ausgerechnet im Finale läßt Thielemann sein Publikum im Stich, denn die Coda des Werkes implodiert ihm. Kein Wunder, denn wenn man ständig das Maximum an Energie fordert, kann man nicht noch mehr nachlegen. Celibidache wußte die Höhepunkte bei Bruckner noch so anzulegen, daß in seinen besten Interpretationen das Ende wirklich überwältigend war – wenn die Sinfonie auf ein solches Ende hin angelegt ist, wie eben die fünfte (ab der Steigerung vor dem B-Dur-Durchbruch des Hauptthemas vom ersten Satz in der Finale-Coda, etwa T. 560). Man höre noch einmal die entsprechende Stelle im genannten live-Mitschnitt von Celidibidache (CD II, Tr. 2, ab ca. 23’30): streng im Tempo (leider mit der von Bruckner nicht vorgesehenen, willkürlich aufwärts oktavierten Trompete T. 586ff), genauso streng in der Dynamik (Bruckner schreibt: „immer fortissimo“), aber doch so fließend, daß ab T. 610 (25’15) sich die Energien mit ungeheuren Dissonanzen in Klang entäußern, so unausweichlich wie wirkungsvoll.
Ebenso hinreißend ist Rudolf Kempe, auch mit den Münchner Philharmonikern, 1975 (Acanta Pilz, 2 CD 442189/90 2), allerdings mit einem ganz anderen Konzept: Die Musik schießt geradezu ins Tutti hinein (CD II, Tr. 4, 21’26), wird etwas langsamer, ab 21’30 das Hauptzeitmaß, dann plötzlich ein ungeheuerlich wirkendes „Weiten“ bei T. 582 (22’09), auch die hoch oktavierte Trompete, die vorletzte Note des Chorals aber immer leicht verzögert und in die Schlußnote hineingleitend, ab T. 610 (23’12) ein ganz leichtes Anwachsen und Verbreitern, dann nochmals ab T. 614 (23:23) ein leichtes Zurücknehmen, wiederum den Choral in der Trompete anfangs entgegen der Partitur hoch oktaviert, ein letztes Anschwellen hin zu Takt 622 (23’39) und schließlich das Hineingleiten in eine insgesamt große Schwere am Ende.
Bei Harnoncourt (Tr. 4, ab 21’15) gibt es keine Sperenzchen, der Durchbruch ist wie von Bruckner gesetzt (T. 564), etwas Nachdruck und Verzögern bei T. 582 ( 22’00), alle Trompeten-Noten wie in der Partitur, ein bißchen Abfangen bei T. 613 (23’04) und dann mit Wucht zum Schluß. Bedauerlich ist nur, daß den Trompeten ein wenig die Luft ausgeht (23’30, in T. 624 scheinen sie gar nicht zu spielen!) und der Pegel hier am oberen Anschlag ist: Der live-Mitschnitt des ORF vom ersten der Konzerte Harnoncourts hatte mich noch mehr überzeugt als das Endprodukt, aber die Wirkung ist immer noch beachtlich, auch wenn sie nicht ganz mit der bei Celibidache oder Kempe mithalten kann.
Und Thielemann? Ab Tr. 4, 22’, hört zunächst nüchternes Herunterspielen, dann ein beständig nachdrückendes Crescendo auf den Haltetönen in Holz und Hörnern (T. 574–82, vergl. 23’05) – wie es natürlich keine Orgel zuwege brächte –, zugleich aber ein Accelerando, zwei Takte Durcheinander (581–2/23’21), dann runtergebolzt, wieder mit oktavierten Trompeten (das scheint eine eingebrannte Retusche in den Münchener Archiv-Stimmen zu sein – sollte es nicht ausdrücklich „ohne Retuschen“sein?), doch hört man sie im Gesamtklang kaum als führende Stimme; dazu kommt ein aufgesetztes Vorwärts-Drängen, glücklicherweise ist die letzte Oktavierungs-Retusche (T. 615) der Trompeten getilgt; das alles bei leicht schwankendem Tempo, und dann die entscheidende Stelle verpatzt (T. 610/24’19), trotz theatralischen leichten Ritardandos und Crescendos; dann geht’s nüchtern in den Schluß, ausgepowert und kraftlos, die Trompeten verpassen ihr legato (T. 626/24’53), und das manierierte Draufsetzen auf den Schlußakkord (23’13) rettet auch nichts mehr. Summa summarum: Erst wird das Publikum aufgeheizt und angestachelt, dann wird ihm die letzte Befriedigung verweigert, weil die Kraft ausgegangen ist. Ich halte das für genauso problematisch (und wenig musikalisch) wie die Ignoranz gegenüber Bruckners ausdrücklich gewünschter „Wissenschaftlichkeit“ nicht nur im Komponieren (und besonders in diesem Werk!), sondern auch bei seinen Interpreten.
Es scheint überflüssig zu erwähnen, dass Christian Thielemann Bruckners spätere Korrekturen, von Nowak bereits 1985 im Revisionsbericht mitgeteilt und von Harnoncourt realisiert, überhaupt nicht interessiert haben. Thielemann erweist sich hier alles in allem als ein Macher, der Bruckners fünfte Sinfonie zur „Beute des Geschmacks“ werden läßt (Adorno). Wer Bruckner üppig und weihevoll mag, ist mit dieser Exekution aus dem Hause Universal Music gut bedient. Wer sich jedoch für Bruckners Absichten und das Werk selbst interessiert, sollte besser zu Celibidache oder Harnoncourt greifen.
Ausdrücklich positiv vermerken möchte ich noch zwei Dinge: Zum einen Thielemanns Entscheidung, zur antiphonalen Aufstellung der Violinen links und rechts zurückzukehren, die Celibidache noch verschmäht hatte; dadurch bleibt zumindest ein Rest an Durchhörbarkeit des vier- bis fünfstimmigen, auf den Streichern aufgebauten Tonsatzes gewahrt, wie sie jüngst bei Ivor Bolton völlig auf der Strecke blieb; zum anderen die Tatsache, daß die Deutsche Grammophon dankenswerterweise auf den Schlußapplaus verzichtet und auch unter Beweis stellt, daß eine einzige normale Audio-CD ohne weiteres 83 Minuten Musik fassen kann...
Dr. Benjamin G. Cohrs [22.03.2005]
Anzeige
Komponisten und Werke der Einspielung
| Tr. | Komponist/Werk | hh:mm:ss |
|---|---|---|
| CD/SACD 1 | ||
| Anton Bruckner | ||
| 1 | Sinfonie Nr. 5 B-Dur WAB 105 |
Interpreten der Einspielung
- Münchner Philharmoniker (Orchester)
- Christian Thielemann (Dirigent)